Natürlich hat Sigmund Freund auch bei den Sammlern dieser Welt sein Lieblingsmotiv entdeckt: In der Sammelleidenschaft witterte er prompt die Ersatzbefriedigung zur Kompensation unerfüllter sexueller Wünsche. Das hielt ihn nicht ab, selbst mit Begeisterung Skarabäen, Ringe und Statuetten zu sammeln.
Tatsächlich kennt die Psychologie viele mögliche Motive für die Leidenschaft des Sammelns: Das können Erkenntnisdrang oder Wissbegier sein (etwa bei wissenschaftlichen Sammlungen), aber auch Eitelkeit und Narzissmus (schon bei Zaren und Kaisern, die um die Wette Preziosen anhäuften oder auch gleich Schlösser horteten). Die Befriedigung, die meisten und schönsten Uhren zu besitzen oder auch die bestgelegenen Immobilien, dürfte auch heute noch ein kraftvolles Motiv darstellen.
“Oft werden Dinge gesammelt”, schreibt der Münchner Sozialpsychologe Dieter Frey, “weil man sich eine Wertanlage verspricht aufgrund des Knappheitsprinzips oder der Wertentwicklung der gesammelten Objekte.” Er nennt keinen Sammelgegenstand, doch die Beschreibung passt trefflich auf eines der Trend-Objekte jüngerer Sammlerbewegungen: den Wein. Doch: jüngere Sammlerbewegung? Wein gibt es doch seit Jahrtausenden, Weinkeller seit Jahrhunderten!

Doch als Investitionsgut für (möglichst vermögende) Anleger wird er erst Anfang dieses Jahrtausends ein Thema; zuvor war Wein ein eher preisstabiles Gut, die Liebhaber kauften die Weine ihres Herzens alle Jahre mit der üblichen konjunkturangepassten Erhöhung zu ähnlichen Preise und füllten ihre Keller einstweilen noch zu gutbürgerlichen Konditionen. Noch 2004 konnte Deutschlands bekannteste Sommeliere Paula Bosch zu den sogenannten Preisexplosionen beschwichtigend sagen: “Selbst das weltbekannte Chateau Mouton Rothschild hat in vierzig Jahren nur zwölf große Weine hervorgebracht. Die meisten Jahrgänge haben sich im Preis nur knapp verdoppelt. Das schaffen Sie in fünfzehn Jahren auch mit Anlagen.”
Richtig ist, dass jede Art von Vermögensvermehrung auch bei der Investition in Weine kaum schneller geht als bei konventionellen Anlagen. Nur wer frühzeitig dabei war, hat gut lachen.

“SpiegelTV” drehte 1997 einen Film über die explosionsartigen Preisanstiege. Da wird gleich in der ersten Szene eine Jeroboam (Großflasche mit sechs Litern Inhalt) Cheval Blanc 1947 bei Christie‘s für 40.000 Euro aufgerufen und für 192.000 verkauft. Es ist die Zeit, in der die fernöstlichen Märkte schlagartig erwachen: Die Bordeaux-Händler zeigen Fax-Bestellungen aus Hongkong und Taiwan für dutzende Kisten der berühmtesten Weine: “Und ganz ohne Limit”, wundert sich ein altgedienter französischer Weinexporteur, “ihnen ist egal, was es kostet, sie wollen sie einfach haben!”
Seither hat der Hype um die großen Bordeaux-Rotweine kaum jemals nachgelassen. 2.500 Euro wurden 2005 für eine Flasche Pétrus bezahlt, die man erst 2008 probieren konnte – etwa zweieinhalb Mal soviel wir im Jahr zuvor. Und noch 2014 ersteigert ein Unbekannter 114 Flaschen Romanée-Conti diverser Jahrgänge für 1.3 Millionen Euro, die Flasche also für 11.400.

Dabei sind die bevorzugten Objekte der Begierde bei Wein-Liebhabern an den Fingern abzuzählen, es sind (fast) nur rote Bordeaux, die eine lange Reifezeit (10 bis 15 Jahre) und eine mehr als hundertjährige Lebensdauer besitzen. Das sind zuvörderst die fünf sogenannten Grand Cru Classée-Chateaus: Latour, Lafite- Rothschild, Margaux, Mouton-Rothschild und Haute Brion, dazu der mehrfache Rekordinhalber Cheval Blanc. Es folgen noch ein paar namhafte Chateaux wie Ausone und Lafleur, schließlich der berühmte Pétrus (mit nur 30.000 Flaschen rar und mit höchsten Wertsteigerungen), Le Pin (noch rarer) und schließlich der einzige, einzigartige Burgunder Domaine Romanée-Conti, der Rarste von Allen und nicht selten doppelt so teuer wie ein Pétrus.
Diese sogenannten Kultweine stellen ja weniger als 0,05 Prozent aller Weine der Welt dar und doch bilden sie – gelegentlich mal vermehrt um einen italienischen, kalifornischen, südafrikanischen (doch niemals deutschen) Exoten – den Kanon der vermögenswirksamen Investitionen dar. In einer Tabelle hat das Weinportal winecollect.eu vor ein paar Jahren die Preisentwicklung der zwölf hier nominierten Weine des (hervorragenden) Jahrgangs 2000 nach sechs Jahren aufgelistet: Sie reicht von einem Plus von 175 Prozent für Chateaux Haute Brion bis zu 620 Prozent bei Chateau Pétrus. In den gesamten achtziger Jahren hatte es dagegen im Durchschnitt nur Steigerungen von fünfzig Prozent gegeben.
Diese Weine werden inzwischen von Weinsammlern gern als Blue Chips bezeichnet; sie reden also schon wie die Börsianer. Und werden dabei von den professionellen Marketingspezialisten und den Medien angefeuert: “Vom Weinkeller zum Portfolio” titelte das “Manager Magazin”, “Mit Wein reich werden” versprach die Wirtschaftswoche für die “alternative Geldanlage”. Es entstanden nach Vorbild des Aktienmarktes Weinfonds, an denen sich die Risikobangeren ab 50 oder 100tausend Euro beteiligen konnten.

Freilich sind die Spielregeln bei der Vermögensvermehrung durch Wein anders als an der Börse. Dort kann ja der Interessierte fast alles über eine Aktie erfahren, ihre Entwicklung, ihre Chancen und über ihren derzeitigen Wert sowieso. Und er kann sie ohne Probleme erwerben. Bei den Kult-Weinen ist ein Kauf nicht ganz so einfach: Eine Flasche Romanée Conti eines bevorzugten Jahrgangs ist kaum zu kriegen (außer vielleicht zu Mondpreisen auf dem Schwarzmatkt), auch sonst muss man mindestens ein Dutzend anderer teurer Flaschen dazu kaufen.
Weine haben ja gegenüber anderen Sammlerobjekten der Vorzug, dass sie weniger werden (und deshalb wertvoller). Gerade in den neuen Wein-Societys wie China werden auch die teuersten Weine ohne viel Rücksicht auf die Preise konsumiert. In Hongkongs feinem Gourmetrestaurant “Pétrus” mit seiner gewaltigen Weinkarte und den wohl meisten Jahrgängen des namengebenden Weins wird dann schon mal eine 47er Magnum geköpft (für umgerechnet rund 49.500 Euro). “Und manche verdünnen ihn dann mit Tonic Water”, verrät kopfschüttelnd der Sommelier, “aber wir sind eben nicht in Bordeaux!”
Dort findet alljährlich im März eine sogenannte Fassprobe statt, Experten und Kritiker geben ihre Einschätzung ab, es können Gebote abgegeben werden, doch erst zwei Monate später wird der Wein in Flaschen abgefüllt und frühestens etwa fünf Jahre später als trinkreif ausgeschenkt. Da kann sich dann die Bewertung schon wieder verändern. Und schließlich gibt es da noch einen gewaltigen Einflusssfaktor, den Börsianer kaum jemals verstehen.
Es ist, als würde der Chefkritiker zum Beispiel des “Handelsblattes” alle wichtigen Aktien nach einer persönlichen Punktetabelle bewerten. Und die Gewinner, die von seinen maximal hundert Punkten nahezu alle erreichen, würden daraufhin prompt Ihren Kurs verdoppeln. Natürlich unvorstellbar!
Und doch passiert genau dies bei den Wein-Preisen. Ein amerikanischer Weinkritiker mit dem unverdächtigen Namen Robert Parker startete Ende der siebziger Jahre mit einem kleinen Newsletter namens – er war ursprünglich Jurist – “The Wine Advocate”. Und der entwickelte sich rasant zu einer so mächtigen Instanz, dass die “New York Times” sie zur “Richterskala der Weinwirtschaft” erklärte.
In der Tat haben Parker und sein zum internationalen Erfolgsmagazin entwickelter Newsletter so manches Erdbeben in den Weinbergen ausgelöst. Die Preisexplosionen der von ihm mit hundert Punkten bewerteten Weine sind Legion. Er hat ganze Güter erst auf die Landkarte der Kultweine gehievt, so “Screaming Eagle” (Kalifornien) oder das Bordeaux-Chateau Valandraud. An dessen plötzlicher Entdeckung haben etliche schnellentschlossene Weinsammler nach eigenem Bekunden ein Vermögen verdient.
Doch Parker hat nach über dreißig Jahren mit, wie er vorgerechnet hat, zehntausend Proben pro Jahr seine Karriere 2013 beendet; sein Magazin wird von ehemaligen MItarbeitern weitergeführt. “Das ist doch nicht mehr dasselbe”, klagt der prominente österreichische Kenner Adi Werner, als Patron des Arlberg Hospiz Herr über einen der höchstkarätigen Weinkeller der Welt, “da wissen doch nun viele nicht mehr, was sie kaufen sollen.”
Die etikettehörigen Chinesen immerhin wissen es und schrecken offenbar auch vor “copies” nicht zurück: “Sie haben zwei Millionen Flaschen Lafite gekauft”, spottet Werner, “aber das Chateau hat nur 180.000 Flasche abgefüllt.” Und dann erzählt er noch, dass “lafit” auf chinesisch so etwas wie Glück bedeutet: “Vielleicht der eigentliche Grund für den Erfolg.”
Weinfälschungen sind indes nicht nur aus China bekannt, wo verdächtigerweise schon leere Flaschen bekannter Kultweine für mehrere hundert Dollar gehandelt werden. Der prominenteste Fall spielte in der High Society der kalifornischen Weinwelt, wo zehn Jahre lang ein kultivierter Mittdreißiger aus Indonesien als beliebter Partylöwe glänzte, teure Weine ersteigerte und seinen Freunden noch viel teurere besorgte, die es eigentlich schon lange nicht mehr gab, so à la Pétrus 1961 in Großflasche.
Arte hat über den eleganten Smokingträger einen abendfüllenden Film gedreht. Als Kurniawan nach zehn Jahren entlarvt wurde, hatte er für über 20 Millionen Dollar gefälschte Kultweine verkauft, an erfahrene Weinsammler, Raritätenkenner und Auktionshäuser. Der Staatsanwalt nannte ihn respektvoll den “größten Weinfälscher der Welt” und verurteilte ihn zu zehn Jahren Haft.
Kurniawan, dessen Spitzname “Dr. Conti” war (nach seinem Lieblingswein Romanée-Conti), war über einen bekannten Fallstrick gestolpert: Er hatte Weine eines Jahrgangs angeboten, in dem diese Marke nicht produziert worden war. Ein prominenter Fall dieser Art brachte 2012 den amerikanischen Sternekoch Charlie Trotter vor den Kadi: Er hatte eine extrem seltene Magnumflasche Romanée-Conti 1947 für 46.200 Dollar verkauft. Nur Pech, dass der glückliche Besitzer sie versichern lassen wollte und die Versicherung feststellte, dass der berühmte Wein in jenem Jahr nicht in Magnumflaschen abgefüllt worden war.
Je älter die Weine, desto schwieriger die Beweislage. Der bekannteste deutsche Wein-Guru Hardy Rodenstock, immer wieder der Weinpanscherei verdächtigt, wurde erst bei seinem größten Coup halbwegs entlarvt: Seine sogenannten Jefferson-Weine, angeblich aus dem Besitz des US-Präsidenten, ein 1787er Chateau-Lafite, angeblich in einem zugemauerten Keller in Paris entdeckt (und für damals 400.000 Mark versteigert) flogen auf, als ein potenter amerikanischer Käufer nachweisen konnte, dass die Jefferson Initialen “Th.J.” mit einem modernen Zahnarztbohrer graviert worden waren.
Alle bekanntgewordenen Fälschungen, da ist sich die Branche einig, sind nur die sprichwörtliche Spitze eines gewaltigen Eisberges. Und das hat zwei plausible Gründe: Die meisten Sammler trinken ihre Weine ja nicht, sondern legen sie, idealerweise zu zwölft in der Originalkiste des Weinguts oder in einer Großflasche, unentkorkt in den Weinkeller. “Das ist ja auch ein Stück Lebenskunst”, spottet ein Hamburger Sammler der jüngeren Generation, “stellen Sie sich vor, man öffnet eine 10.000-Euro-Flasche, und dann kommt ein billiges Chiantigemisch raus…”
Dabei gilt auch das Tasting nur bedingt als Mittel, Fälschungen zu entdecken: “Wer weiß denn schon, wie ein 47er Chateau Margaux schmeckt”, spottete schon vor Jahren Weinpapst Parker, “und kann sich daran erinnern.” Und die “Weindetektivin” Maureen Downey, die Kurniawan mit zur Strecke gebracht hat, ist sich ganz sicher: “Kein Mensch auf der ganzen Welt kann am Geschmack erkennen, ob ein Wein echt ist. Wer das Gegenteil behauptet, lügt.”
Text: Horst Dieter Ebert
Bordeaux Chedi Andermatt Mouton Rothschild Rotwein Weinsammeln
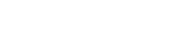
Previous Next